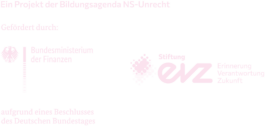Das unbekannte Kind

Geschichten, die hier nicht erzählt werden können
Zahlreiche Lebensgeschichten von Kindern aus verbotenen Beziehungen können wir nicht erzählen. Die Gründe dafür sind vielfältig. So ist bis heute nicht bekannt, wie viele dieser Kinder es gegeben hat. Ihre Zahl lässt sich nicht bestimmen und auch nicht schätzen. Aus Angst vor Verfolgung versuchten Mütter zudem, ihre Schwangerschaft zu verbergen oder den Partner zu verleugnen und ihr Kind als Kind eines anderen Mannes auszugeben. Diese Fälle sind überwiegend nicht rekonstruierbar. Teilweise wissen die Kinder bis heute nicht, dass sie aus einer verbotenen Beziehung hervorgegangen sind. Manche, die es wissen, möchten nicht öffentlich darüber sprechen. Der Aufruf zur Mitwirkung am Projekt »trotzdem da!« wird außerdem einen Großteil der betroffenen Kinder gar nicht erreicht haben. Dies gilt insbesondere für jene, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind bzw. nicht in Deutschland leben.
Unerzählt bleiben ebenfalls die Geschichten der Kinder, die nicht überlebt haben. Von einigen dieser Kinder gibt es aber zumindest Spuren, die nachgezeichnet werden können.

Annemarie Hofinger, Tochter einer Österreicherin und eines polnischen Zwangsarbeiters, 1943
Annemaries Eltern, Aloisia Hofinger und Josef Gowdek, wurden 1942 wegen ihrer Beziehung denunziert. Aloisia kam in das KZ Ravensbrück, Josef wurde erhängt. Nach der Haft sah Aloisia ihre Tochter, die im Oktober 1943 an Diphtherie gestorben war, nicht wieder.
Foto: unbekannt. Privatbesitz Elfriede Schober

Helmut, vermutlich 1947 oder 1948
Die deutsche Familie Engelhardt nahm 1944 Helmut, das Kind einer Deutschen und eines französischen Zwangsarbeiters, auf. Helmut wurde ca. 1949 nach Frankreich repatriiert. Der Enkel von Helmuts Adoptivschwester, René Vincze, versucht heute, ihn zu finden und Kontakt zu ihm aufzunehmen.
Foto: unbekannt. Privatbesitz René Vincze

Gedenkstein für Annemarie und Wilfried Gerken im Bremervörder Stadtteil Iselersheim, 2023
Wilfried wurde als Kind zu Verwandten in die USA geschickt. Als er 1990 vom Heimatverein Iselersheim erfuhr, dass seine Mutter Annemarie Gerken und sein Vater, der polnische Zwangsarbeiter Stefan Szablewski, eine verbotene Beziehung hatten, reagierte er abweisend.
Foto: Hermann Röttjer. Privatbesitz Röttjer
Leben ohne die Geschichte der Eltern
Es ist davon auszugehen, dass die meisten Kinder, die aus einer verbotenen Beziehung hervorgegangen sind, davon nichts wissen. Adoptierte Kinder erfuhren oft nicht, wer ihre leiblichen Eltern waren. Für einige war die Beziehung zu ihren Adoptiveltern wiederum so eng, dass sie nicht nach ihren leiblichen Eltern suchen wollten. In Familien, in denen die Kinder bei einem leiblichen Elternteil aufgewachsen sind, war häufig viel Mut und Nachdruck erforderlich, um das Schweigen in der Familie zu lösen. In vielen Fällen wurde in den Familien nur der Vorname des Elternteils, der Kriegsgefangene*r oder Zwangsarbeiter*in gewesen war, überliefert. Andere Kinder erfuhren gar nicht, wer ihr zweiter leiblicher Elternteil ist. Manche begannen erst im hohen Alter zu suchen, als die meisten, die ihnen hätten Informationen geben können, bereits verstorben waren. Nicht allen war es möglich, mit den wenigen dennoch erhaltenen Informationen eine Recherche in Archiven durchzuführen.
»Wir suchen unseren deutschen Bruder/Vetter!
Mein Onkel, Henricus Theodorus CORVERS, war im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter bei der Reichspost in Leipzig.
[…]
Seit kurzem wissen wir, dass er auch einen Sohn mit einer deutschen Frau hatte, geboren zwischen 1943 und 1945. Der Name des Kindes ist vermutlich Heinrich. Leider kennen wir den Namen der Frau nicht.
Wir möchten gern mit ihm in Kontakt kommen; er hat noch 4 Geschwister!«
Suchaufruf der niederländischen Familie Corvers in Leipzig, 2018
Die Angehörigen eines niederländischen Zwangsarbeiters, der während des Zweiten Weltkrieges in Leipzig eingesetzt war, suchen ihren Halbbruder bzw. Cousin, der vermutlich »Heinrich« heißt. Die Suche blieb bisher erfolglos.
Privatbesitz Corvers
»Meine Mutter empfindet Scham über ihre Herkunft, die in der Familie tabuisiert wurde. Noch heute spricht sie kaum darüber.«
Sascha Kirchner, Enkel einer Deutschen und eines italienischen Militärinternierten
Scham und Schweigen
Für einige Kinder aus verbotenen Beziehungen ist die eigene Geschichte eine so große Belastung, dass sie nicht bereit sind, darüber zu sprechen. Für manche ist der Schmerz, nicht erfahren zu haben, wer ihre leiblichen Eltern sind, zu groß. Auch kann die Erinnerung an die aufgrund ihrer Herkunft erfahrene Ausgrenzung und Abwertung als zu bedrückend empfunden werden. Andere sprechen nur mit Freund*innen oder in ihrer Familie über die Geschichte der Eltern und möchten sie nicht öffentlich erzählen.
»Ausländerkinder-Pflegestätten«
Schwangere Zwangsarbeiterinnen aus Polen und der Sowjetunion wurden in den ersten Kriegsjahren in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Ab 1943 mussten sie jedoch im Deutschen Reich bleiben und häufig schon kurz nach der Entbindung wieder arbeiten. Die Kinder wurden zwangsadoptiert oder in von der NSDAP eingerichtete Heime, sogenannte »Ausländerkinder-Pflegestätten«, gebracht. Sie befanden sich oft in Baracken oder Ställen. Die Kinder wurden gezielt vernachlässigt. Aufgrund vorenthaltener medizinischer Versorgung und mangelhafter Hygiene und Ernährung betrug die Sterblichkeit dort bis zu 90 %. Insgesamt haben mindestens 50 000 Kinder diese Heime nicht überlebt. Wie viele Kinder aus verbotenen Beziehungen darunter sind, ist nicht bekannt.

»Ausländerkinder-Pflegeheim« des Volkswagenwerks in Rühen im Landkreis Gifhorn, 1945
Das Heim war eines von drei »Ausländerkinder-Pflegeheimen« für die Kinder osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen des Volkswagenwerks mit Sitz in der »Stadt des KdF-Wagens«, dem heutigen Wolfsburg. 350 bis 400 Kinder starben in diesen drei Heimen durch gezielte Vernachlässigung.
Foto: unbekannt. The National Archives, London
Das unbekannte Kind

Geschichten, die hier nicht erzählt werden können
Zahlreiche Lebensgeschichten von Kindern aus verbotenen Beziehungen können wir nicht erzählen. Die Gründe dafür sind vielfältig. So ist bis heute nicht bekannt, wie viele dieser Kinder es gegeben hat. Ihre Zahl lässt sich nicht bestimmen und auch nicht schätzen. Aus Angst vor Verfolgung versuchten Mütter zudem, ihre Schwangerschaft zu verbergen oder den Partner zu verleugnen und ihr Kind als Kind eines anderen Mannes auszugeben. Diese Fälle sind überwiegend nicht rekonstruierbar. Teilweise wissen die Kinder bis heute nicht, dass sie aus einer verbotenen Beziehung hervorgegangen sind. Manche, die es wissen, möchten nicht öffentlich darüber sprechen. Der Aufruf zur Mitwirkung am Projekt »trotzdem da!« wird außerdem einen Großteil der betroffenen Kinder gar nicht erreicht haben. Dies gilt insbesondere für jene, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind bzw. nicht in Deutschland leben.
Unerzählt bleiben ebenfalls die Geschichten der Kinder, die nicht überlebt haben. Von einigen dieser Kinder gibt es aber zumindest Spuren, die nachgezeichnet werden können.

Annemarie Hofinger, Tochter einer Österreicherin und eines polnischen Zwangsarbeiters, 1943
Annemaries Eltern, Aloisia Hofinger und Josef Gowdek, wurden 1942 wegen ihrer Beziehung denunziert. Aloisia kam in das KZ Ravensbrück, Josef wurde erhängt. Nach der Haft sah Aloisia ihre Tochter, die im Oktober 1943 an Diphtherie gestorben war, nicht wieder.
Foto: unbekannt. Privatbesitz Elfriede Schober

Helmut, vermutlich 1947 oder 1948
Die deutsche Familie Engelhardt nahm 1944 Helmut, das Kind einer Deutschen und eines französischen Zwangsarbeiters, auf. Helmut wurde ca. 1949 nach Frankreich repatriiert. Der Enkel von Helmuts Adoptivschwester, René Vincze, versucht heute, ihn zu finden und Kontakt zu ihm aufzunehmen.
Foto: unbekannt. Privatbesitz René Vincze

Gedenkstein für Annemarie und Wilfried Gerken im Bremervörder Stadtteil Iselersheim, 2023
Wilfried wurde als Kind zu Verwandten in die USA geschickt. Als er 1990 vom Heimatverein Iselersheim erfuhr, dass seine Mutter Annemarie Gerken und sein Vater, der polnische Zwangsarbeiter Stefan Szablewski, eine verbotene Beziehung hatten, reagierte er abweisend.
Foto: Hermann Röttjer. Privatbesitz Röttjer
Leben ohne die Geschichte der Eltern
Es ist davon auszugehen, dass die meisten Kinder, die aus einer verbotenen Beziehung hervorgegangen sind, davon nichts wissen. Adoptierte Kinder erfuhren oft nicht, wer ihre leiblichen Eltern waren. Für einige war die Beziehung zu ihren Adoptiveltern wiederum so eng, dass sie nicht nach ihren leiblichen Eltern suchen wollten. In Familien, in denen die Kinder bei einem leiblichen Elternteil aufgewachsen sind, war häufig viel Mut und Nachdruck erforderlich, um das Schweigen in der Familie zu lösen. In vielen Fällen wurde in den Familien nur der Vorname des Elternteils, der Kriegsgefangene*r oder Zwangsarbeiter*in gewesen war, überliefert. Andere Kinder erfuhren gar nicht, wer ihr zweiter leiblicher Elternteil ist. Manche begannen erst im hohen Alter zu suchen, als die meisten, die ihnen hätten Informationen geben können, bereits verstorben waren. Nicht allen war es möglich, mit den wenigen dennoch erhaltenen Informationen eine Recherche in Archiven durchzuführen.
»Wir suchen unseren deutschen Bruder/Vetter!
Mein Onkel, Henricus Theodorus CORVERS, war im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter bei der Reichspost in Leipzig.
[…]
Seit kurzem wissen wir, dass er auch einen Sohn mit einer deutschen Frau hatte, geboren zwischen 1943 und 1945. Der Name des Kindes ist vermutlich Heinrich. Leider kennen wir den Namen der Frau nicht.
Wir möchten gern mit ihm in Kontakt kommen; er hat noch 4 Geschwister!«
Suchaufruf der niederländischen Familie Corvers in Leipzig, 2018
Die Angehörigen eines niederländischen Zwangsarbeiters, der während des Zweiten Weltkrieges in Leipzig eingesetzt war, suchen ihren Halbbruder bzw. Cousin, der vermutlich »Heinrich« heißt. Die Suche blieb bisher erfolglos.
Privatbesitz Corvers
»Meine Mutter empfindet Scham über ihre Herkunft, die in der Familie tabuisiert wurde. Noch heute spricht sie kaum darüber.«
Sascha Kirchner, Enkel einer Deutschen und eines italienischen Militärinternierten
Scham und Schweigen
Für einige Kinder aus verbotenen Beziehungen ist die eigene Geschichte eine so große Belastung, dass sie nicht bereit sind, darüber zu sprechen. Für manche ist der Schmerz, nicht erfahren zu haben, wer ihre leiblichen Eltern sind, zu groß. Auch kann die Erinnerung an die aufgrund ihrer Herkunft erfahrene Ausgrenzung und Abwertung als zu bedrückend empfunden werden. Andere sprechen nur mit Freund*innen oder in ihrer Familie über die Geschichte der Eltern und möchten sie nicht öffentlich erzählen.
»Ausländerkinder-Pflegestätten«
Schwangere Zwangsarbeiterinnen aus Polen und der Sowjetunion wurden in den ersten Kriegsjahren in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Ab 1943 mussten sie jedoch im Deutschen Reich bleiben und häufig schon kurz nach der Entbindung wieder arbeiten. Die Kinder wurden zwangsadoptiert oder in von der NSDAP eingerichtete Heime, sogenannte »Ausländerkinder-Pflegestätten«, gebracht. Sie befanden sich oft in Baracken oder Ställen. Die Kinder wurden gezielt vernachlässigt. Aufgrund vorenthaltener medizinischer Versorgung und mangelhafter Hygiene und Ernährung betrug die Sterblichkeit dort bis zu 90 %. Insgesamt haben mindestens 50 000 Kinder diese Heime nicht überlebt. Wie viele Kinder aus verbotenen Beziehungen darunter sind, ist nicht bekannt.

»Ausländerkinder-Pflegeheim« des Volkswagenwerks in Rühen im Landkreis Gifhorn, 1945
Das Heim war eines von drei »Ausländerkinder-Pflegeheimen« für die Kinder osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen des Volkswagenwerks mit Sitz in der »Stadt des KdF-Wagens«, dem heutigen Wolfsburg. 350 bis 400 Kinder starben in diesen drei Heimen durch gezielte Vernachlässigung.
Foto: unbekannt. The National Archives, London
trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.
Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.
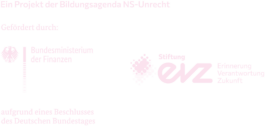
trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.
Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.